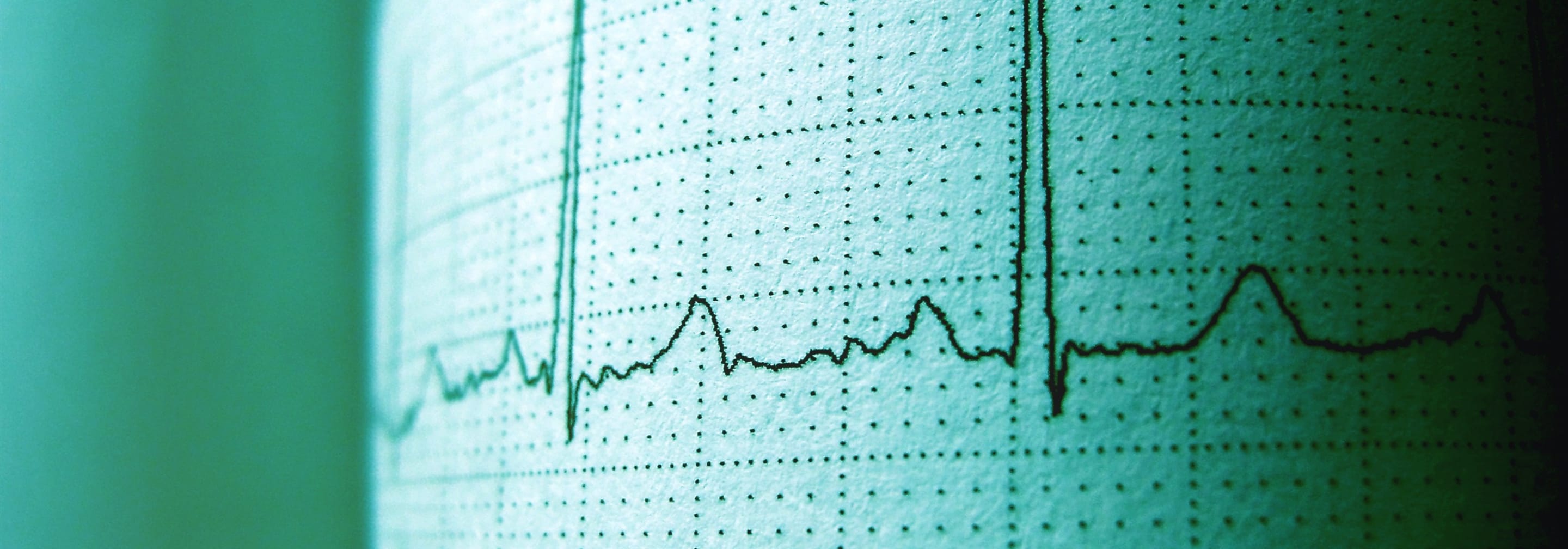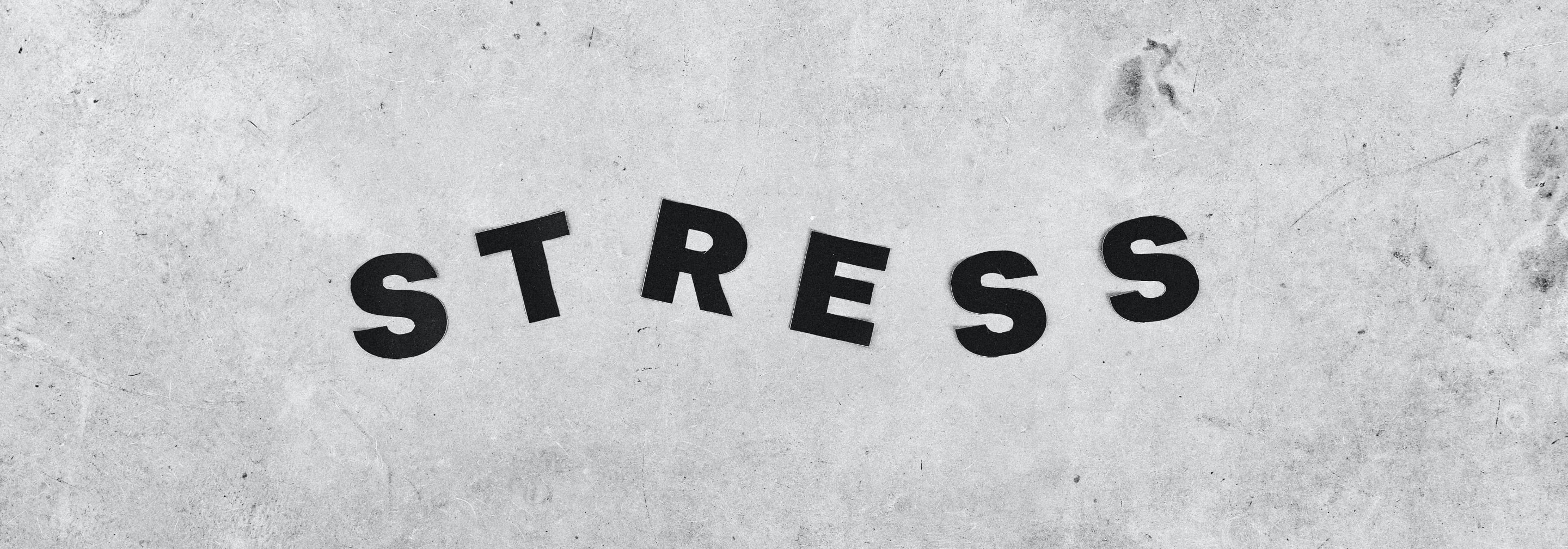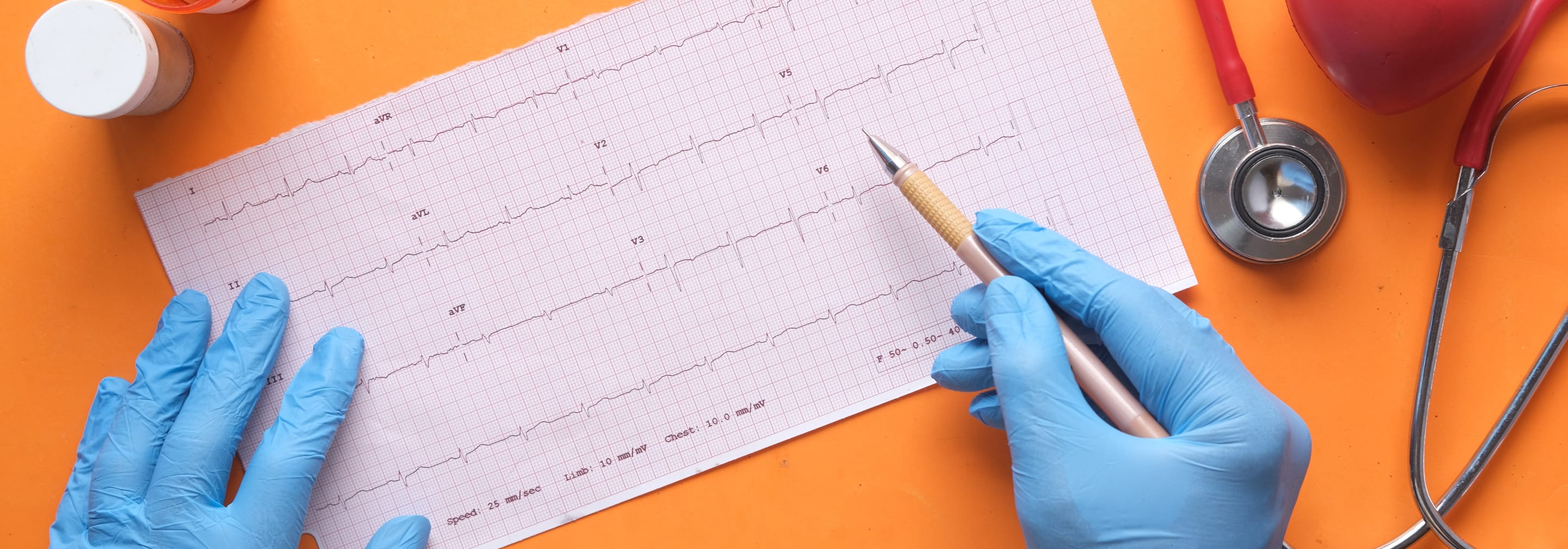Herzfrequenzvariabilität: Was sagt die HRV aus?

Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) beschreibt die natürlichen Schwankungen in den Zeitintervallen zwischen zwei Herzschlägen. Diese Unterschiede sind kein Fehler, sondern ein Zeichen der Anpassungsfähigkeit deines Körpers – sie zeigen, wie gut dein autonomes Nervensystem auf Belastung, Erholung und Stress reagiert (Sammito et al., 2024).
Obwohl die Begriffe Herzfrequenzvariabilität und Herzratenvariabilität synonym verwendet werden, bezeichnen sie dasselbe physiologische Phänomen: die Variation der sogenannten RR-Intervalle – also der Zeit zwischen zwei Herzschlägen. Eine hohe HRV steht in der Regel für Regenerationsfähigkeit, Resilienz und ein gesundes Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Eine niedrige HRV kann dagegen ein frühes Warnsignal für Stress, Erschöpfung oder eine eingeschränkte Regulationsfähigkeit des vegetativen Nervensystems sein (Zeid et al., 2023; Tarvainen et al., 2023).
In diesem Artikel erfährst du, wie du deine HRV zuverlässig misst, was sie über Stress und Erholung aussagt und mit welchen Strategien du sie langfristig verbessern kannst – etwa durch Atmung, Bewegung und erholsamen Schlaf.
Kurz gesagt: Was ist die Herzfrequenzvariabilität?
Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) ist ein Maß für die Flexibilität deines Herz-Kreislauf-Systems. Sie zeigt, wie stark die Zeitabstände zwischen zwei Herzschlägen variieren. Eine höhere HRV deutet auf ein gesundes, anpassungsfähiges Nervensystem hin – eine niedrigere HRV kann auf Stress oder Überlastung hindeuten (Sammito et al., 2024).
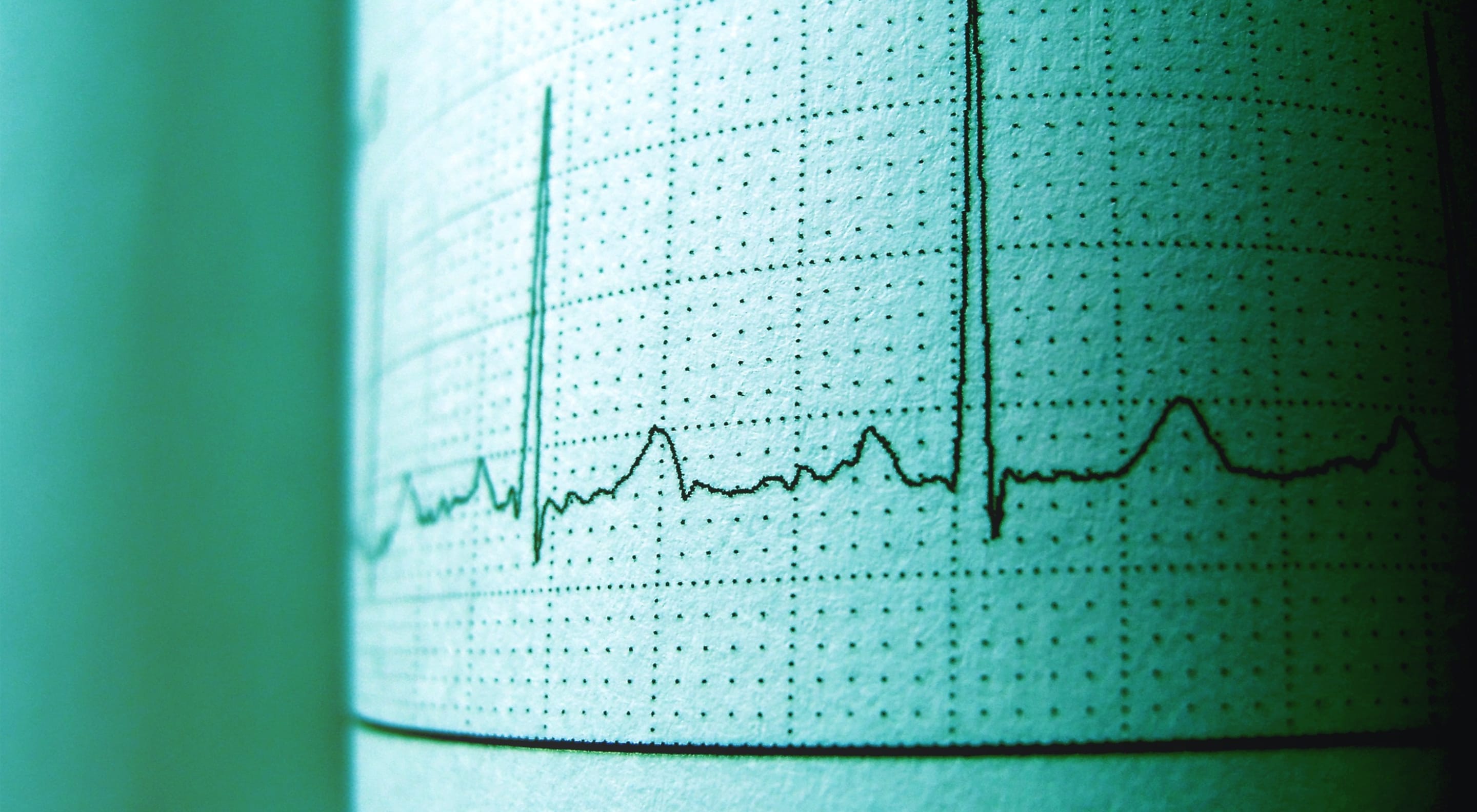
Was ist die Herzratenvariabilität (HRV)
Was ist die Herzfrequenzvariabilität (HRV)?
Ein gesundes Herz schlägt nicht in einem starren Takt wie ein Metronom. Die Zeit zwischen zwei Herzschlägen schwankt – und genau diese Schwankungen beschreibt die Herzfrequenzvariabilität (HRV). Sie wird in Millisekunden gemessen und zeigt, wie flexibel dein Herz-Kreislauf-System auf körperliche und psychische Anforderungen reagiert (Sammito et al., 2024).
Die HRV misst die Abstände zwischen den Kontraktionen der Herzkammern, also die sogenannten RR-Intervalle. Je größer die Unterschiede zwischen diesen Abständen sind, desto anpassungsfähiger ist dein vegetatives Nervensystem. Eine hohe HRV steht in der Regel für Erholung, Anpassungsfähigkeit und Gesundheit, während eine niedrige HRV auf Stress oder Überlastung hindeuten kann (Tarvainen et al., 2023; Zeid et al., 2023).
In der Sportwissenschaft und Stressforschung wird die HRV verwendet, um Regeneration, Belastbarkeit und das Verhältnis von Aktivierung und Erholung im Nervensystem zu bewerten. Studien zeigen, dass Personen mit einer hohen HRV ein bis zu 40 % geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben als Personen mit niedrigen Werten (Frontiers in Physiology, 2024).
Vegetatives Nervensystem: Sympathikus und Parasympathikus
Das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Gegenspielern: dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Der Sympathikus aktiviert den Körper bei Stress oder Belastung („Fight-or-Flight“), während der Parasympathikus Regeneration und Ruheprozesse steuert („Rest-and-Digest“). Eine ausgewogene Balance zwischen beiden Systemen ist entscheidend für Leistungsfähigkeit, Schlafqualität und langfristige Gesundheit.
Die Messung der HRV ist eine einfache und nicht-invasive Methode, um dieses Gleichgewicht objektiv zu beurteilen – sie zeigt, wie gut dein Körper zwischen Anspannung und Entspannung wechseln kann (Sammito et al., 2024).
Tipp: Möchtest du deine Regeneration und HRV gezielt verbessern? In unserem BLACKROLL Online-Schlafkurs lernst du, wie du durch erholsamen Schlaf und gezielte Entspannungstechniken dein Nervensystem nachhaltig stärkst.

Wie misst man die HRV?
Die Messung der Herzfrequenzvariabilität (HRV) erfasst die zeitlichen Abstände zwischen zwei Herzschlägen – sogenannte RR-Intervalle. Diese Daten zeigen, wie gut das autonome Nervensystem auf Belastung und Erholung reagiert. Es gibt mehrere Verfahren, die in der Forschung und Praxis eingesetzt werden (Shaffer & Ginsberg, 2017; Ernst, 2014).
1. Elektrokardiographie (EKG) – der Goldstandard
Die Elektrokardiographie (EKG) gilt als die präziseste Methode zur HRV-Messung. Dabei werden Elektroden auf der Haut angebracht, um die elektrischen Signale des Herzens aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnung kann sowohl in Ruhe als auch über 24 Stunden erfolgen (Langzeit-EKG). Anschließend berechnet eine Software die Variationen der Herzschlag-Intervalle und leitet daraus verschiedene HRV-Parameter ab, z. B.:
- SDNN (Standard Deviation of NN-Intervals): Gesamtvariabilität aller Herzschläge – Maß für allgemeine Anpassungsfähigkeit.
- RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences): Kurzzeitvariabilität – zeigt Parasympathikus-Aktivität.
- LF/HF-Ratio: Verhältnis von Sympathikus- zu Parasympathikus-Aktivität.
Die EKG-Analyse erfolgt meist ärztlich oder unter Anleitung von Sport- und Gesundheitswissenschaftlern. Studien bestätigen, dass sie die höchste Genauigkeit bei der Erfassung von HRV-Parametern bietet (Tarvainen et al., 2023).
2. Photoplethysmographie (PPG) – die alltagstaugliche Methode
Die Photoplethysmographie (PPG) ist eine optische Messmethode, bei der ein Lichtsensor – etwa in Smartwatches oder Fingersensoren – die Blutvolumenänderungen in den Gefäßen erfasst. Das reflektierte Licht wird in ein Pulssignal umgewandelt, aus dem sich HRV-Daten ableiten lassen. Die PPG-Methode ermöglicht eine einfache, kontinuierliche Messung im Alltag, weist jedoch bei Bewegung oder schwankender Hautdurchblutung eine geringere Genauigkeit auf als das EKG (Lu et al., 2020).
Für Training, Stressmonitoring oder Schlafanalysen ist die PPG-Messung dennoch ein nützliches Instrument, um Trends in der HRV zu erkennen und individuelle Regenerationsphasen zu verfolgen.
Wer hat die Herzfrequenzvariabilität erstmals gemessen?
Die Ursprünge der Forschung zur Herzfrequenzvariabilität (HRV) reichen bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurück. Der britische Neurophysiologe Sir Charles Sherrington (1857–1952) beschrieb erstmals die Bedeutung der nervalen Regulation des Herzrhythmus im Rahmen seiner Arbeiten zum autonomen Nervensystem – eine Entdeckung, die später mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde (Sherrington, 1906).
Die erste quantitative Messung der HRV erfolgte jedoch erst in den 1960er-Jahren. Die amerikanischen Physiologen Arthur J. Moss und Charles M. Kellenberger zeigten 1965, dass die Analyse der Abstände zwischen Herzschlägen (RR-Intervalle) Rückschlüsse auf die Aktivität des autonomen Nervensystems erlaubt (Moss & Kellenberger, 1965). Ihre Forschung legte den Grundstein für die heutige HRV-Analyse.
In den folgenden Jahrzehnten entwickelten Wissenschaftler wie Ronald Akselrod und Kollegen (1981) Methoden zur Spektralanalyse der HRV, mit denen sich die Aktivität von Sympathikus und Parasympathikus erstmals getrennt erfassen ließ. Heute ist die HRV ein fester Bestandteil der Forschung in Medizin, Sportwissenschaft, Psychologie, Neurologie und Schlafforschung.
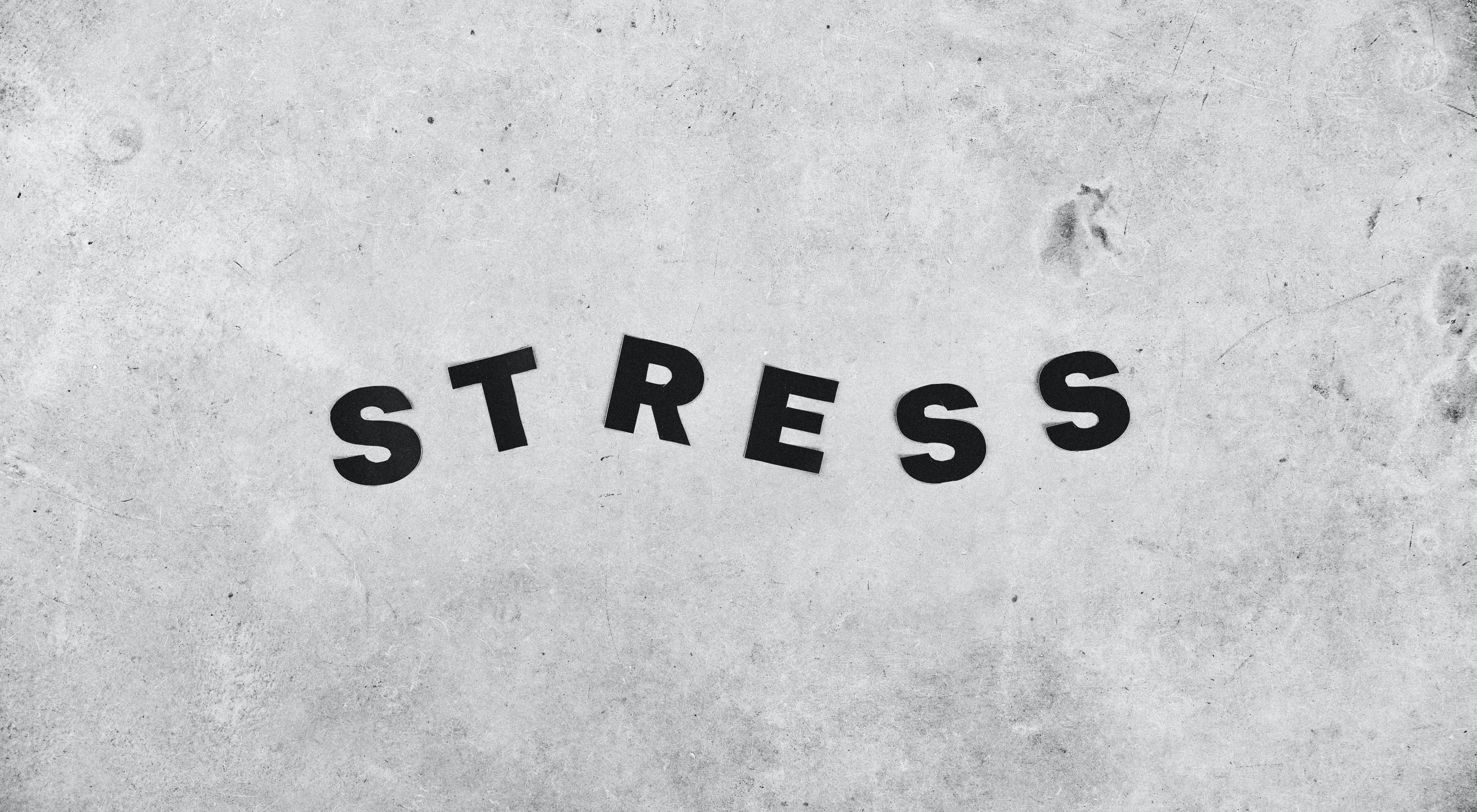
HRV und Stress: Was dein Körper dir zeigt
Stress messen mit Hilfe der HRV
Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) gilt als einer der zuverlässigsten physiologischen Marker für die Stressregulation des Körpers. Sie zeigt, wie gut dein autonomes Nervensystem zwischen Aktivierung (Sympathikus) und Entspannung (Parasympathikus) wechseln kann. Eine niedrige HRV weist oft auf eine erhöhte Stressbelastung hin, während eine hohe HRV auf gute Erholung und Resilienz schließen lässt (Shaffer & Ginsberg, 2017; Thayer et al., 2012).
Wie die HRV Stress sichtbar macht
- Akuter Stress: Aktiviert den Sympathikus – Herzschlag wird schneller, HRV sinkt kurzfristig.
- Chronischer Stress: Führt zu dauerhaft erniedrigter HRV und reduziert die Anpassungsfähigkeit des Körpers.
- Erholung & Entspannung: Aktivieren den Parasympathikus – Herzfrequenz sinkt, HRV steigt.
Messungen zeigen, dass Personen mit niedriger HRV häufiger unter Schlafstörungen, Erschöpfung und kognitiver Überlastung leiden (Kim et al., 2018).
Du kannst also mithilfe der HRV nachvollziehen, wie dein Körper auf Stress reagiert und wie schnell du dich davon erholst. Wenn deine Werte über mehrere Tage niedrig bleiben, kann das ein Zeichen dafür sein, dass du dich überlastest – Zeit also, einen Gang zurückzuschalten und auf ausreichend Schlaf, Bewegung und Erholung zu achten.
Dennoch ist wichtig: Die HRV ist kein Diagnoseinstrument, sondern ein physiologischer Indikator. Sie sollte immer im Kontext anderer Gesundheitsparameter und deines subjektiven Empfindens interpretiert werden (Ernst, 2014).
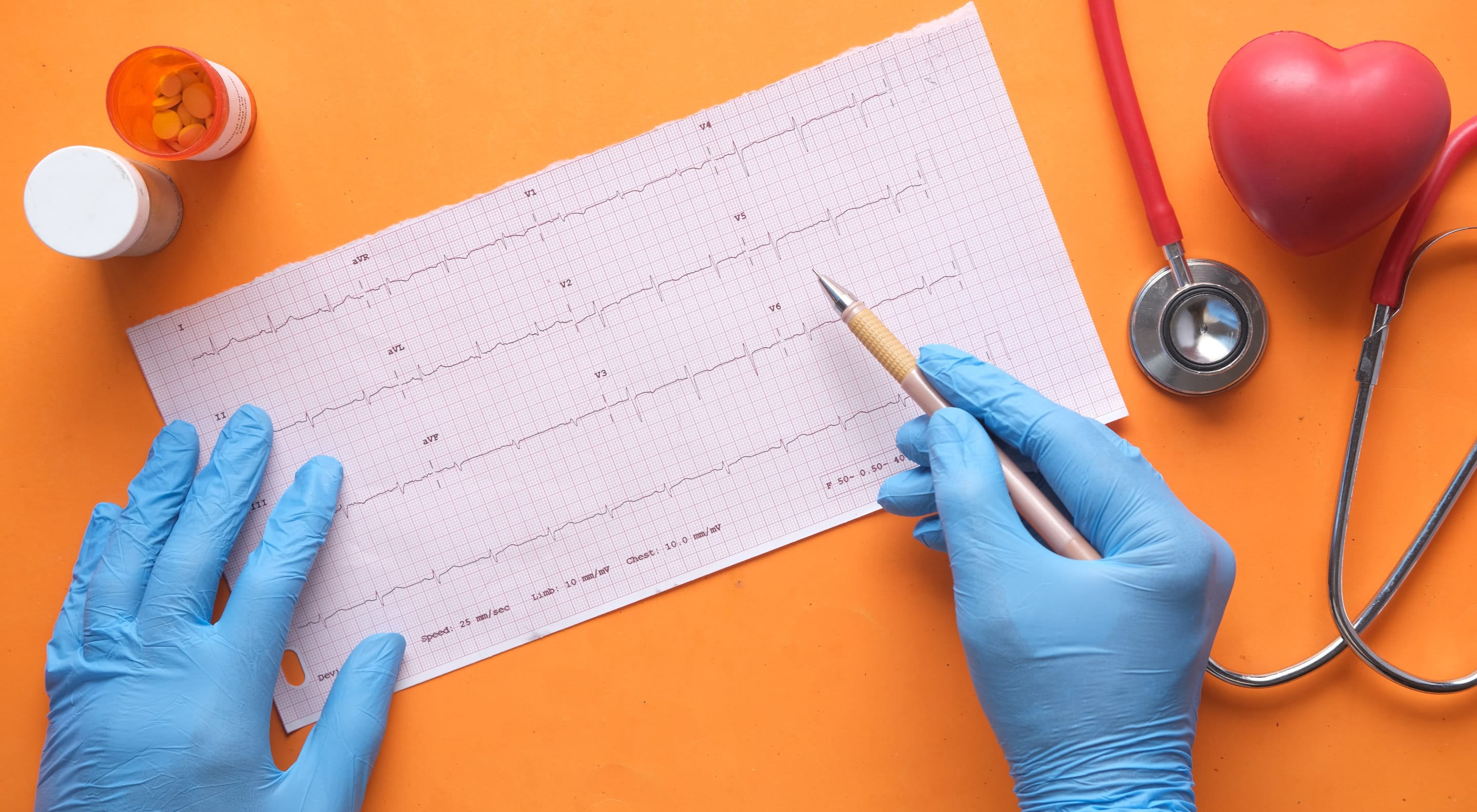
HRV im Lebensverlauf und Schlaf
Herzfrequenzvariabilität: Referenzwerte nach Alter
Es gibt keine einheitliche Zahl, die als „guter“ HRV-Wert gilt. Die individuelle Herzfrequenzvariabilität hängt von vielen Faktoren ab – darunter Alter, Geschlecht, Fitnesszustand, Stresslevel und Schlafqualität. Kinder und junge Erwachsene zeigen in der Regel eine höhere Variabilität als ältere Menschen, da ihr autonomes Nervensystem flexibler reagiert (Shaffer & Ginsberg, 2017).
Vergleiche zwischen Personen sind nur eingeschränkt aussagekräftig. Wichtiger ist, wie sich deine eigenen Werte im Verlauf entwickeln. Dennoch können Durchschnittsbereiche als grobe Orientierung dienen (Umetani et al., 1998; Nunan et al., 2010).
Tabelle: Durchschnittliche HRV-Bereiche nach Alter
Alter (Jahre) | Durchschnittliche HRV (ms) |
|---|---|
20–25 | 55–105 |
26–30 | 45–95 |
31–35 | 40–85 |
36–40 | 35–75 |
41–45 | 35–65 |
46–55 | 30–55 |
56–65 | 25–50 |
Hinweis: Diese Werte dienen nur der Orientierung und basieren auf populationsbezogenen Durchschnittsdaten aus Studien. Individuelle Abweichungen sind normal und sollten im Kontext von Gesundheit, Lebensstil und Erholung bewertet werden (Umetani et al., 1998).
Herzfrequenzvariabilität im Schlaf
Während des Schlafs liefert die Herzfrequenzvariabilität wertvolle Hinweise auf den Erholungszustand deines Körpers. Sie spiegelt wider, wie aktiv der Parasympathikus – also das „Ruhesystem“ des Körpers – während der Nacht ist. Eine höhere HRV deutet auf eine gute Regeneration und Schlafqualität hin (Chua et al., 2019).
Die HRV verändert sich im Verlauf der Nacht, je nach Schlafphase. In der Tiefschlafphase überwiegt meist die parasympathische Aktivität, wodurch die HRV ansteigt. In REM-Phasen dagegen sinkt sie leicht, da das autonome Nervensystem variabler arbeitet. Daher gibt es keine festen Normwerte für die HRV im Schlaf – ausschlaggebend ist dein persönlicher Verlauf über mehrere Nächte hinweg (Trinder et al., 2001).
Wenn du regelmäßig misst, kannst du daraus einen eigenen Referenzwert ableiten und erkennen, wie gut du dich über Nacht erholst. Moderne HRV-Tracker oder Schlafmessungen helfen dabei, diese Veränderungen sichtbar zu machen.
HRV-Training und Biofeedback: Balance lernen statt steigern
Wie du deine HRV im Alltag unterstützen kannst
Die Herzfrequenzvariabilität lässt sich durch verschiedene Gewohnheiten positiv beeinflussen. Besonders hilfreich sind regelmäßige Bewegung, bewusste Atmung, ausreichend Schlaf und ein ausgewogenes Stressmanagement. Studien zeigen, dass selbst kleine Anpassungen im Lebensstil messbare Effekte auf die HRV haben können (Shaffer & Ginsberg, 2017).
Wenn du praktische Übungen und Routinen suchst, um gezielt an deiner HRV zu arbeiten – etwa durch Atemübungen, Entspannungstechniken oder regelmäßige Regeneration –, findest du im Beitrag „Herzfrequenzvariabilität verbessern“ eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Trainingsmethoden und Anwendungsbeispielen.
HRV-Training und Biofeedback: Wie du deine Herzfrequenzvariabilität gezielt beobachtest
Das sogenannte HRV-Training bezeichnet den gezielten Einsatz von Techniken, um die Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems zu schulen. Dabei steht nicht die kurzfristige Erhöhung der Herzfrequenzvariabilität im Vordergrund, sondern das Bewusstsein für die Wechselwirkung zwischen Atmung, Herzschlag und Entspannung (Lehrer et al., 2020).
Was passiert beim HRV-Biofeedback?
Beim HRV-Biofeedback wird die Herzfrequenzvariabilität mithilfe von Sensoren in Echtzeit gemessen. Der Proband erhält ein visuelles oder akustisches Feedback – zum Beispiel in Form von Kurven, Farben oder Tönen – und kann dadurch lernen, seine Atmung und Herzfrequenz bewusst zu synchronisieren.
Studien zeigen, dass regelmäßiges Biofeedback-Training das Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus verbessert und die physiologische Stressregulation unterstützt (Lehrer & Gevirtz, 2014; Goessl et al., 2017).
Das HRV-Biofeedback wird heute in verschiedenen Bereichen eingesetzt – etwa in der Sportpsychologie, der Verhaltensmedizin und der Schmerztherapie. Klinische Studien weisen darauf hin, dass es Symptome wie Bluthochdruck, chronische Schmerzen und Angstzustände lindern kann, indem es die parasympathische Aktivität stärkt (Lehrer et al., 2020).
Wenn du mehr über praktische Methoden, Atemtechniken und Routinen erfahren möchtest, findest du diese im weiterführenden Artikel „Herzfrequenzvariabilität verbessern“ .

Herzfrequenz und Puls: Wie sich dein Herz im Tagesverlauf anpasst
Was macht eine gesunde Herzfrequenz aus?
Die Herzfrequenz beschreibt die Anzahl der Herzschläge pro Minute (beats per minute = bpm) und ist nicht mit der Herzfrequenzvariabilität (HRV) zu verwechseln. Während die HRV die zeitlichen Schwankungen zwischen den einzelnen Schlägen misst, zeigt die Herzfrequenz, wie häufig das Herz in einer Minute schlägt. Beide Werte liefern unterschiedliche, aber ergänzende Informationen über dein Herz-Kreislauf-System (Zhao et al., 2020).
Die Herzfrequenz variiert je nach Alter, Geschlecht, Fitnesszustand und Tagesform. Bei Erwachsenen gilt ein Ruhepuls zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute als normal. Gut trainierte Ausdauersportler erreichen häufig Werte unter 60 bpm, was auf eine effiziente Herzfunktion hinweist (Boudoulas et al., 2015). Frauen haben tendenziell einen etwa 5–10 bpm höheren Ruhepuls, da ihr Herz kleiner ist und für die gleiche Blutmenge schneller schlagen muss.
Durchschnittliche Ruheherzfrequenz nach Alter
Alter (Jahre) | Durchschnittliche Ruhefrequenz (bpm) |
|---|---|
Neugeborene | 120–140 |
Kinder (6–12) | 75–110 |
Jugendliche | 65–90 |
Erwachsene | 60–80 |
Trainierte Personen | 45–60 |
Senioren (>65) | 65–85 |
Eine erhöhte Ruheherzfrequenz (> 90 bpm) kann auf Stress, Bewegungsmangel oder ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinweisen. Eine niedrige Frequenz (< 60 bpm) wird als Bradykardie bezeichnet – sie ist bei trainierten Personen häufig unbedenklich, kann aber in seltenen Fällen auf Schilddrüsen- oder Herzleitungsstörungen hindeuten (Fox et al., 2007).
Ein gesundes Herz reagiert flexibel: Bei körperlicher oder geistiger Aktivität steigt die Frequenz, in Ruhe sinkt sie wieder. Diese Anpassungsfähigkeit – kombiniert mit einer stabilen HRV – ist ein Zeichen für eine gute kardiale und vegetative Regulation (Shaffer & Ginsberg, 2017).
Puls im Tagesverlauf: So ändert sich der Herzschlag im Laufe des Tages
Der Puls bzw. die Herzfrequenz folgt einem natürlichen Tagesrhythmus, der durch innere biologische Uhren – insbesondere den zirkadianen Rhythmus – gesteuert wird. Alter, körperliche Aktivität, Stresslevel und Gesundheitszustand beeinflussen zusätzlich, wie stark dein Puls im Verlauf des Tages schwankt (Furlan et al., 1990).
Typischerweise ist die Herzfrequenz am Morgen am niedrigsten, steigt im Verlauf des Vormittags und frühen Nachmittags an und sinkt abends wieder ab. Diese Veränderungen spiegeln den Wechsel von Ruhe, Aktivität und Erholungsphasen wider. Während körperlicher Belastung oder emotionalem Stress erreicht der Puls kurzfristig seine höchsten Werte (Shaffer & Ginsberg, 2017).
Typischer Tagesverlauf der Herzfrequenz
- Morgen (06–09 Uhr): niedrige Frequenz – Körper befindet sich in Ruhephase
- Vormittag (09–12 Uhr): Anstieg durch Aktivierung und Bewegung
- Nachmittag (12–18 Uhr): höchster Bereich – Stoffwechsel und Leistungsfähigkeit auf Maximum
- Abend (18–22 Uhr): allmähliche Absenkung – Übergang zur Regeneration
- Nacht (22–06 Uhr): niedrigste Werte – parasympathische Dominanz im Schlaf
Wenn du wissen möchtest, wie sich dein Puls im Alltag verändert, helfen kontinuierliche Messungen mit Smartwatches oder Brustgurten. Moderne Sensoren zeichnen deine Herzfrequenz über den Tag auf und zeigen typische Muster oder Auffälligkeiten an. So kannst du nachvollziehen, wie dein Lebensstil, Stress oder Schlaf dein Herz beeinflussen.
Anmerkung: Im Alltag werden Puls und Herzfrequenz oft synonym verwendet. Medizinisch betrachtet beschreibt die Herzfrequenz die Anzahl der Herzschläge pro Minute, während der Puls die spürbaren Druckwellen in den Arterien misst. Bei gesunden Menschen verlaufen beide Werte nahezu synchron, bei bestimmten Herzrhythmusstörungen (z. B. Vorhofflimmern) kann der Puls jedoch von der tatsächlichen Herzfrequenz abweichen (Furlan et al., 1990).

Fazit zur Herzratenvariabilität und der damit verbundenen Gesundheit
Fazit: Herzfrequenzvariabilität und Gesundheit
Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) gilt heute als ein sensibler Indikator für die Anpassungsfähigkeit und Resilienz des Körpers. Eine höhere HRV wird in zahlreichen Studien mit besserer kardiovaskulärer Gesundheit, effektiverer Stressregulation und einem insgesamt stabileren Wohlbefinden in Verbindung gebracht (Thayer et al., 2012; Shaffer & Ginsberg, 2017).
Eine dauerhaft niedrige HRV kann hingegen auf Stress, Schlafmangel oder gesundheitliche Dysbalancen hinweisen. Sie sollte jedoch nicht als isoliertes Maß für Gesundheit interpretiert werden – Faktoren wie Alter, Geschlecht, Fitness und genetische Einflüsse spielen ebenfalls eine Rolle (Sammito et al., 2024).
Ein gesunder Lebensstil mit ausreichend Bewegung, erholsamem Schlaf, ausgewogener Ernährung und bewusster Atmung kann die Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems positiv unterstützen. Verfahren wie kontrolliertes Atmen, Meditation oder HRV-Biofeedback fördern langfristig Balance und Entspannung, ohne dass der Fokus allein auf der „Steigerung“ der HRV liegt.
Die regelmäßige Beobachtung deiner HRV kann dir helfen, deinen körperlichen Zustand besser zu verstehen und Belastungen frühzeitig zu erkennen – als Teil einer ganzheitlichen Gesundheitsstrategie, nicht als isolierter Messwert.
FAQ: Die häufigsten Fragen zur Herzfrequenzvariabilität
Quellen
- Boudoulas, K. D., Paraskevaidis, I. A., Boudoulas, H., & Triposkiadis, F. (2015). The resting heart rate: Clinical implications and prognostic significance. Current Cardiology Reviews, 11(3), 293–302. https://doi.org/10.2174/1573403X11666141216221212
- Chua, C. P., et al. (2019). Heart rate variability in sleep and stress research: A review. Sleep Medicine Reviews, 45, 15–27. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2019.02.001
- Ernst, G. (2014). Hidden signals—The history and basic science of heart rate variability. Frontiers in Public Health, 2, 80. https://doi.org/10.3389/fpubh.2014.00080
- Fox, K., Borer, J. S., Camm, A. J., Danchin, N., Ferrari, R., Sendon, J. L. L., Steg, P. G., Tardif, J. C., Tavazzi, L., Tendera, M., & Heart Rate Working Group. (2007). Resting heart rate in cardiovascular disease. Journal of the American College of Cardiology, 50(9), 823–830. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.04.079
- Furlan, R., Guzzetti, S., Crivellaro, W., Dassi, S., Tinelli, M., Baselli, G., Cerutti, S., Lombardi, F., Pagani, M., & Malliani, A. (1990). Circadian changes in autonomic nervous system activity in relation to cardiovascular function. American Journal of Physiology, 258(4), H967–H976. https://doi.org/10.1152/ajpheart.1990.258.4.H967
- Goessl, V. C., Curtiss, J. E., & Hofmann, S. G. (2017). The effect of heart rate variability biofeedback training on stress and anxiety: A meta-analysis. Psychological Medicine, 47(15), 2578–2586. https://doi.org/10.1017/S0033291717001003
- Kim, H. G., Cheon, E. J., Bai, D. S., Lee, Y. H., & Koo, B. H. (2018). Stress and heart rate variability: A meta-analysis and review of the literature. Psychiatry Investigation, 15(3), 235–245. https://doi.org/10.30773/pi.2017.08.17
- Lehrer, P. M., & Gevirtz, R. (2014). Heart rate variability biofeedback: How and why does it work? Frontiers in Psychology, 5, 756. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00756
- Lehrer, P. M., Vaschillo, E., & Vaschillo, B. (2020). Resonance frequency biofeedback training to increase cardiac variability: Rationale and manual for training. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 45(4), 295–312. https://doi.org/10.1007/s10484-020-09475-9
- Lu, G., Yang, F., Taylor, J. A., & Stein, J. F. (2020). Can photoplethysmography be used for heart rate variability analysis? Journal of Clinical Monitoring and Computing, 34(4), 653–662. https://doi.org/10.1007/s10877-019-00385-0
- Moss, A. J., & Kellenberger, C. M. (1965). Electrocardiographic study of beat-to-beat variation in normal subjects. American Heart Journal, 70(5), 661–671. https://doi.org/10.1016/0002-8703(65)90088-3
- Nunan, D., Sandercock, G. R. H., & Brodie, D. A. (2010). Normative values for short-term heart rate variability in healthy adults: A systematic review. European Heart Journal, 31(5), 600–608. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp257
- Sammito, S., Thielmann, B., & Böckelmann, I. (2024). Update: Factors influencing heart rate variability – A narrative review. Frontiers in Physiology, 15, 1430458. https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1430458
- Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An overview of heart rate variability metrics and norms. Frontiers in Public Health, 5, 258. https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258
- Sherrington, C. S. (1906). The integrative action of the nervous system. Yale University Press.
- Tarvainen, M. P., Niskanen, J. P., Lipponen, J. A., Ranta-aho, P. O., & Karjalainen, P. A. (2023). Heart rate variability in the prediction of mortality: A systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 147, 105107. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105107
- Thayer, J. F., Åhs, F., Fredrikson, M., Sollers, J. J., & Wager, T. D. (2012). A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: Implications for heart–brain interactions in stress. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36(2), 747–756. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.11.009
- Trinder, J., Kleiman, J., Carrington, M., Smith, S., Breen, S., Tan, N., & Kim, Y. (2001). Autonomic activity during human sleep as a function of time and sleep stage. Journal of Sleep Research, 10(4), 253–264. https://doi.org/10.1046/j.1365-2869.2001.00263.x
- Umetani, K., Singer, D. H., McCraty, R., & Atkinson, M. (1998). Twenty-four hour time domain heart rate variability and heart rate: Relations to age and gender over nine decades. Journal of the American College of Cardiology, 31(3), 593–601. https://doi.org/10.1016/S0735-1097(97)00554-8
- Zhao, D., Guallar, E., Ouyang, P., Subramanya, V., Vaidya, D., Ndumele, C. E., Lima, J. A., Allison, M. A., Shah, S. J., & Hays, A. G. (2020). Heart rate and heart rate variability: Relationship with cardiovascular health. European Heart Journal, 41(8), 743–753. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz802