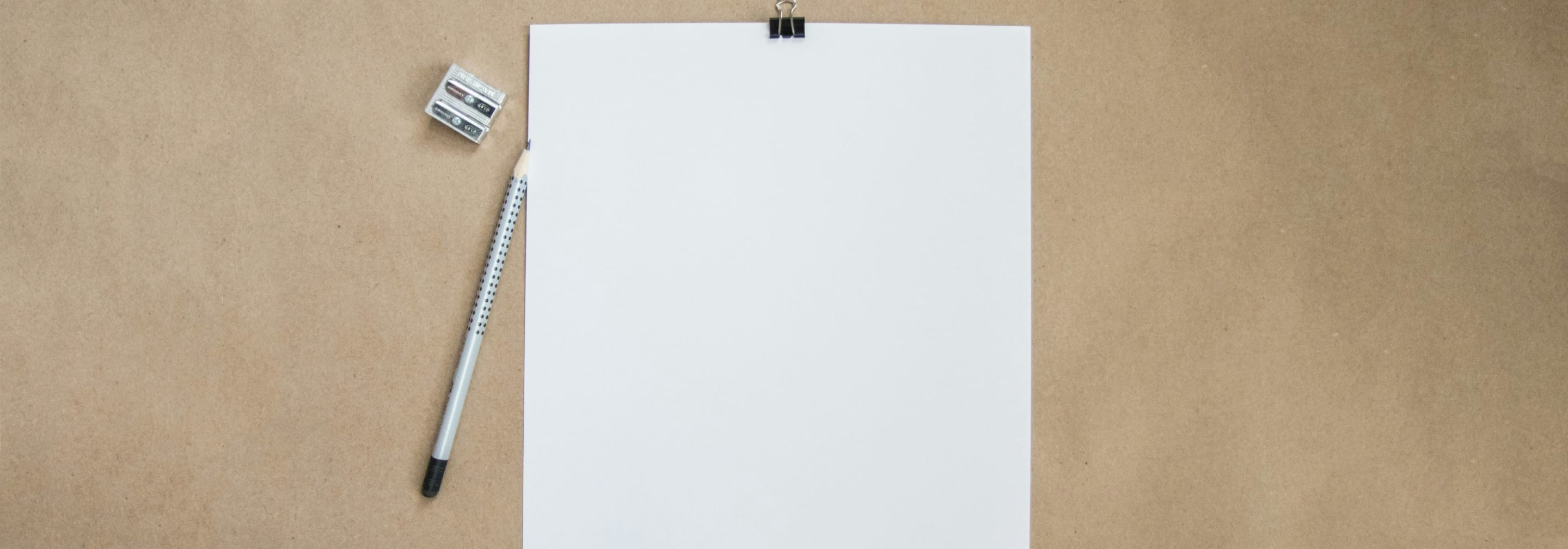Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS/ME): Ursachen, Symptome, Therapie und Alltagstipps

Müdigkeit oder Erschöpfung ist nach anstrengenden Arbeitstagen oder intensiven Sporteinheiten ein völlig normaler Zustand, den wir alle kennen. Doch bei manchen Menschen hält sie über Wochen, Monate oder sogar Jahre an – unabhängig von Schlaf, Erholung oder Lebensstil. In diesen Fällen kann ein chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS), auch Myalgische Enzephalomyelitis (ME) genannt, die Ursache sein. Insbesondere nach Infektionen wie Covid-19 kann CFS auftreten.
Unser Artikel gibt einen umfassenden Überblick über das chronische Erschöpfungssyndrom, erklärt die Ursachen, Symptome, Diagnosemöglichkeiten, Therapieansätze und praktische Alltagstipps, damit Betroffene ihr Leben besser gestalten können.

Was ist das chronische Erschöpfungssyndrom (CFS)?
Das chronische Erschöpfungssyndrom ist eine komplexe, multisystemische Erkrankung. Das bedeutet, dass mehrere Organsysteme gleichzeitig betroffen sein können, darunter das Nervensystem, das Immunsystem, der Stoffwechsel und die Hormonregulation.
Hauptsymptom ist tiefe, anhaltende Erschöpfung; oft begleitet von kognitiven Problemen, Schlafstörungen, Schmerzen in Muskeln und Gelenken sowie verstärkter Empfindlichkeit gegenüber Licht, Geräuschen und Gerüchen.
Diese Kombination aus körperlicher, geistiger und emotionaler Belastung macht CFS/ME zu einer erheblich einschränkenden Erkrankung, die das tägliche Leben stark beeinflussen kann.
Besonders in den letzten Jahren ist CFS in den Fokus gerückt, nicht zuletzt durch Long Covid. Denn viele Patient:innen berichten, dass die Symptome nach einer Covid-Infektion auftreten oder sich verschlimmern und anhalten.
Laut der ‘ME/CFS Research Foundation’ gab es Ende 2024 etwa 650.000 ME/CFS-Fälle in Deutschland– zusätzlich zu geschätzten 871.000 Long-COVID-Betroffenen. Diese Erkrankung betrifft also über 1,5 Millionen Menschen.
Ursachen und Risikofaktoren
Die genauen Ursachen von CFS sind noch nicht vollständig geklärt, Forschung und klinische Beobachtungen weisen jedoch auf ein Zusammenspiel von physiologischen, immunologischen, hormonellen und psychologischen Faktoren hin:
Infektionen
Viren wie Epstein-Barr, Herpesviren oder Coxsackieviren stehen im Verdacht, CFS auszulösen
Long Covid wird zunehmend als Auslöser anerkannt: Viele Patient:innen entwickeln Monate nach der Infektion anhaltende Erschöpfung (Fatigue). Eine Studie der Charité Berlin untersuchte Patient:innen mit starker Fatigue sechs Monate nach der Infektion und verfolgte sie bis zu 20 Monate. Die Ergebnisse zeigen: Patient:innen, bei denen sich ein chronisches Fatigue-Syndrom entwickelt hat, bleiben in vielen Fällen dauerhaft schwer beeinträchtigt. Bei Betroffenen ohne ME/CFS-Kriterien bessern sich die Symptome hingegen langsam, teilweise deutlich.
Post-(acute) COVID-19 Vaccination Syndrome (PACVS / PCVS) nach der Impfung löst laut einem Studienregister 2024 in über 80 Prozent der Fälle chronische Fatigue aus, neben weiteren Symptomen wie beispielsweise Schmerzen und Muskelschwäche.
Immunsystem und Entzündungen
Auch eine fehlregulierte Immunantwort und chronische Entzündungen könnten die Erschöpfungszustände begünstigen
Stoffwechsel- und Hormonstörungen
Schilddrüse, Nebennierenfunktion und Energieproduktion auf Zellebene können betroffen sein. Eine Störung der Mitochondrienfunktion wird als einer der Hauptursachen bei CFS gezählt.
Störfelder im Mundraum
Chronische Entzündungen im Kieferknochen (FDOKs) können oft unbemerkt das gesamte System betreffende Gifte ins Blut freisetzen, stille Entzündungen verursachen und dauerhaft das Immunsystem aktivieren. Das kann zu unterschiedlichsten Symptomen führen, auch zu chronischer Erschöpfung und Schmerzen. FDOKs kommen häufig im Zusammenhang mit wurzelbehandelten oder gezogenen Zähnen vor.
Psychische Belastung
Stress allein verursacht CFS zwar nicht, kann die Symptomatik jedoch verstärken
Genetische Prädisposition
Familiäre Häufung deutet auf eine genetische Anfälligkeit hin

Symptome und Diagnose
Chronische Müdigkeit, Brain Fog, Muskelschmerzen oder Schlafstörungen – die Symptome von CFS/ME sind vielfältig und oft schwer zu erkennen. Eine frühzeitige Diagnose durch Ausschluss anderer Erkrankungen und gezielte Symptomdokumentation hilft Betroffenen, ihre Beschwerden besser einzuordnen und passende Therapieansätze zu finden.
Hauptsymptome
CFS zeigt sich durch ein breites Spektrum körperlicher, geistiger und emotionaler Symptome, die die Lebensqualität erheblich einschränken können. Betroffene erleben nicht nur anhaltende Müdigkeit, sondern auch vielfältige Begleiterscheinungen, die häufig unterschätzt werden. Dazu zählen:
- Chronische Müdigkeit:
Das wohl auffälligste Merkmal von CFS ist eine dauerhafte, tiefgehende Erschöpfung, die mindestens sechs Monate anhält und durch Schlaf oder Ruhe nicht merklich abnimmt.
- Muskel- und Gelenkschmerzen:
Viele Patient:innen leiden unter diffusen, wechselnden Schmerzen in Muskeln und Gelenken, die nicht durch Entzündungen oder Verletzungen erklärt werden. Diese Schmerzen verschlimmern sich oft nach körperlicher Belastung und können zu Schonhaltungen und zusätzlicher Verspannung führen.
- Kopfschmerzen und migräneartige Beschwerden:
Häufig treten anhaltende Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen oder migräneartige Symptome auf, die die Konzentrationsfähigkeit weiter einschränken.
- Magen-Darm-Beschwerden:
Betroffene berichten oft von Übelkeit, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung, die die Nahrungsaufnahme erschweren und die allgemeine Erschöpfung verstärken können.
- Empfindlichkeit auf Licht, Geräusche und Gerüche:
Viele Patient:innen reagieren überempfindlich auf Reize wie grelles Licht, laute Geräusche oder starke Gerüche, was soziale Kontakte oder Arbeitssituationen stark einschränken kann.
- Kognitive Einschränkungen (Brain Fog):
Konzentrationsprobleme, vergessene Wörter, Schwierigkeiten beim Planen von Aufgaben und allgemeine geistige Erschöpfung gehören zu den zentralen Symptomen. Dieser „Brain Fog“ beeinträchtigt Alltag, Beruf und soziale Aktivitäten erheblich.
- Post-Exertional Malaise (PEM):
Ein besonderes Kennzeichen von CFS ist die Verschlechterung der Symptome nach körperlicher oder geistiger Belastung. Selbst kurze Spaziergänge, das Treppensteigen oder konzentriertes Arbeiten können zu einem Wochen anhaltenden Erschöpfungszustand führen. Diese symptomatische Überlastung unterscheidet CFS deutlich von normaler Müdigkeit und macht die richtige Dosierung von Aktivitäten zu einer zentralen Herausforderung im Alltag.
- Weitere Begleiterscheinungen:
Zusätzlich treten häufig Schlafstörungen, Schwindel, Herzrasen, Temperaturempfindlichkeiten oder depressive Verstimmungen auf. Betroffene fühlen sich oft missverstanden, da viele Symptome von außen unsichtbar sind.
Wichtig: Die Symptomatik von CFS ist vielschichtig und individuell unterschiedlich, aber immer stark einschränkend. Eine frühzeitige Diagnose und angepasste Therapie- und Selbsthilfestrategien sind entscheidend, um die Belastung zu reduzieren und den Alltag besser zu bewältigen.

Diagnose des chronischen Erschöpfungssyndroms
Die Diagnose des chronischen Erschöpfungssyndroms gilt als besonders herausfordernd, da es keinen einzelnen Laborwert oder Test gibt, der die Erkrankung eindeutig beweist. Laboruntersuchungen auf z. B. Entzündungsmarker, immunologische Dysbalance oder Mitochondriopathie sind dennoch ein wesentlicher diagnostischer Bestandteil. Ärzt:innen müssen daher einen differenzierten, systematischen Ansatz wählen, der sowohl körperliche als auch psychische Faktoren berücksichtigt. Dazu zählen:
Ausschluss anderer Erkrankungen
Ein zentraler Bestandteil der Diagnostik ist die ausschließende Untersuchung anderer Ursachen für die Symptome. Dazu gehören beispielsweise:Schilddrüsenerkrankungen und hormonelle Dysbalance: Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse und ihrer Hormone kann Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und Muskelschmerzen verursachen. Auch andere Hormone, wie z. B. Testosteronmangel, führen häufig zu ähnlichen Symptomen.
Nährstoffmangel: Eine Unterversorgung mit energieliefernden Makronährstoffen und Mikronährstoffen, die essentiell für die Energieproduktion in den Mitochondrien – den „Energiekraftwerken“ der Zelle – sind, löst über ATP-Mangel Erschöpfung aus.
Schlafstörungen wie Schlafapnoe: Unregelmäßiger Schlaf oder Atemaussetzer in der Nacht führen zu chronischer Müdigkeit und Erschöpfung am Tag.
Depression oder Angststörungen: Psychische Erkrankungen können ähnliche Symptome wie CFS hervorrufen, erfordern aber andere Behandlungsansätze.
Fibromyalgie: Diese Schmerzstörung weist Überschneidungen mit CFS auf, etwa Muskel- und Gelenkschmerzen, ist jedoch primär ein Schmerzsyndrom.
Atlasblockade und instabile HWS: Ist der oberste Halswirbel, der Atlas, oder sind andere Wirbel der HWS z. B. durch ein Schleudertrauma funktionell instabil, kann das unterschiedlichste Körpersysteme beeinflussen. Unter anderem anhaltende Müdigkeit.
Patientenbefragungen und Symptomtagebücher
Neben Laborwerten und bildgebenden Verfahren spielt die subjektive Wahrnehmung der Patient:innen eine zentrale Rolle. Ärzt:innen arbeiten daher häufig mit:
Symptomtagebüchern: Hier dokumentieren Betroffene tägliche Energielevel, Schlafqualität, Schmerzen, vegetative und kognitive Beschwerden.
Fatigue-Scores und standardisierte Fragebögen: Diese helfen, die Schwere der Erschöpfung objektiv zu erfassen und Veränderungen im Verlauf zu dokumentieren.
Viele Menschen mit CFS berichten, dass die lange Zeit bis zur Diagnose psychische Anstrengung und Frustration erzeugt, was die Symptome zusätzlich verschärfen kann.
Durch die Kombination aus ausschließender Diagnostik, Leitlinien und subjektiver Symptomdokumentation können Ärzt:innen die Diagnose CFS sicherer stellen und gleichzeitig den Grundstein für eine individuelle Therapieplanung legen.
Die Diagnosestellung kann Monate bis Jahre in Anspruch nehmen und ist komplex und zeitaufwendig, aber essenziell. Für Betroffene ist dieser Prozess oft emotional belastend, da sie trotz deutlicher Beschwerden keine klare Antwort erhalten und sich häufig missverstanden fühlen.
Hinweis: CFS wird in der internationalen Klassifikation der Krankheiten unter dem ICD-10-Code G93.3 geführt. Diese Einordnung hilft dabei, CFS von anderen neurologischen oder psychischen Erkrankungen abzugrenzen und einen standardisierten Rahmen für Forschung und Therapie zu schaffen.

Therapie & Behandlungsmöglichkeiten
CFS ist bisher nicht heilbar, dennoch gibt es vielfältige Ansätze, die Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität Betroffener deutlich zu verbessern. Ein individueller Behandlungsplan, der medizinische, körperliche und psycho-emotionale Aspekte kombiniert, kann Erkrankten helfen, den Alltag besser zu bewältigen. Dazu zählen:
Medikamentöse Therapie:
Medikamente kommen bei CFS gezielt zum Einsatz, um einzelne Symptome zu lindern. Dazu zählen Schmerzmittel bei muskulären Beschwerden, Antidepressiva bei belastender Stimmungslage oder Schlafmittel bei starken Schlafstörungen.
Wichtig ist: Diese Medikamente behandeln nicht die Ursache von CFS, sondern unterstützen gezielt im Umgang mit Beschwerden. Eine ärztliche Beratung ist entscheidend, um die passende Dosierung und Kombination zu finden.
Physiotherapie & Bewegung
Sanfte körperliche Aktivität kann die Muskel- und Mitochondrienfunktion verbessern, die Durchblutung fördern und die allgemeine Leistungsfähigkeit unterstützen. Geeignet sind beispielsweise:
- Yoga oder Stretching für Beweglichkeit, Entspannung und die Stabilisierung von Muskeln und Gelenken.
- Rehabilitative Maßnahmen (Reha): Gezielte physiotherapeutische Programme können die körperliche Funktion langfristig verbessern.
Ernährung & Mikronährstoffe
Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung kann das Wohlbefinden positiv beeinflussen. Dazu zählen:
- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
- Versorgung mit Vitamin D, Vitamin B12, Omega-3, Coenzym Q10, Magnesium, Eisen und andere, falls ein Mangel vorliegt
- Kleine, regelmäßige Mahlzeiten können helfen, das Energielevel stabil zu halten
Atemtraining
Durch eine gezielt verlangsamte Bauchatmung mit Atempausen nach der Ausatmung (Buteyko-Methode) steigt die Sauerstoffversorgung, das Zwerchfell wird in seiner Funktion unterstütz, der Vagusnerv aktiviert und mentale sowie myofasziale Entspannung gefördert.
Hormesis – die Anpassungsfähigkeit stärken
Wohldosierte Reize auf die Körperfunktionen verbessern die Mitochondrienproduktion und -funktion und regulieren das Immunsystem. Möglichkeiten sind beispielsweise:
- Kalte Duschen oder Bäder
- Fastenzeiten
- Moderate Fitnesseinheiten
Psychologische Unterstützung
CFS wirkt sich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch stark aus. Folgende Maßnahmen können Betroffene unterstützen:
- Verhaltenstherapie, um Strategien im Umgang mit Stress, Symptomen und Erschöpfung zu entwickeln
- Akzeptanz-Strategien und Psychoedukation, um die eigene Situation besser zu verstehen
- Förderung der Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, den Alltag zu gestalten
Alternative Ansätze
Komplementäre Methoden können zwar nicht heilen, aber ergänzend helfen, zum Beispiel:
- Akupunktur zur Schmerzlinderung
Meditation und Achtsamkeitsübungen zur Stressreduktion

Leben mit CFS/ME
Das Leben mit CFS erfordert Selbstmanagement und Anpassung. Ein strukturierter Alltag kann Betroffenen helfen, mit den starken Erschöpfungssymptomen besser umzugehen. Ein achtsamer Umgang mit den eigenen Kräften, kombiniert mit gezielten Anpassungen im Alltag, ist die Basis für mehr Stabilität und Lebensqualität bei CFS. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen:
- Tagesplanung & Pacing: Aktivitäten sollten bewusst eingeteilt und mit ausreichend Ruhephasen kombiniert werden. Ziel ist es, die eigenen Energiereserven nicht zu überlasten, sondern Schritt für Schritt im individuellen Tempo zu handeln.
- Fatigue-Tagebuch: Das regelmäßige Dokumentieren von Symptomen, Schlafqualität, Ernährung und Bewegung gibt wertvolle Hinweise auf Belastungsgrenzen und mögliche Auslöser von Verschlechterungen.
- Selbsthilfegruppen: Der Austausch mit anderen Betroffenen kann Motivation geben, Verständnis fördern und das Gefühl von Isolation verringern.
Arbeitsplatzgestaltung: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Lösungen und regelmäßige Pausen erleichtern es, Beruf und Krankheit miteinander zu vereinbaren.
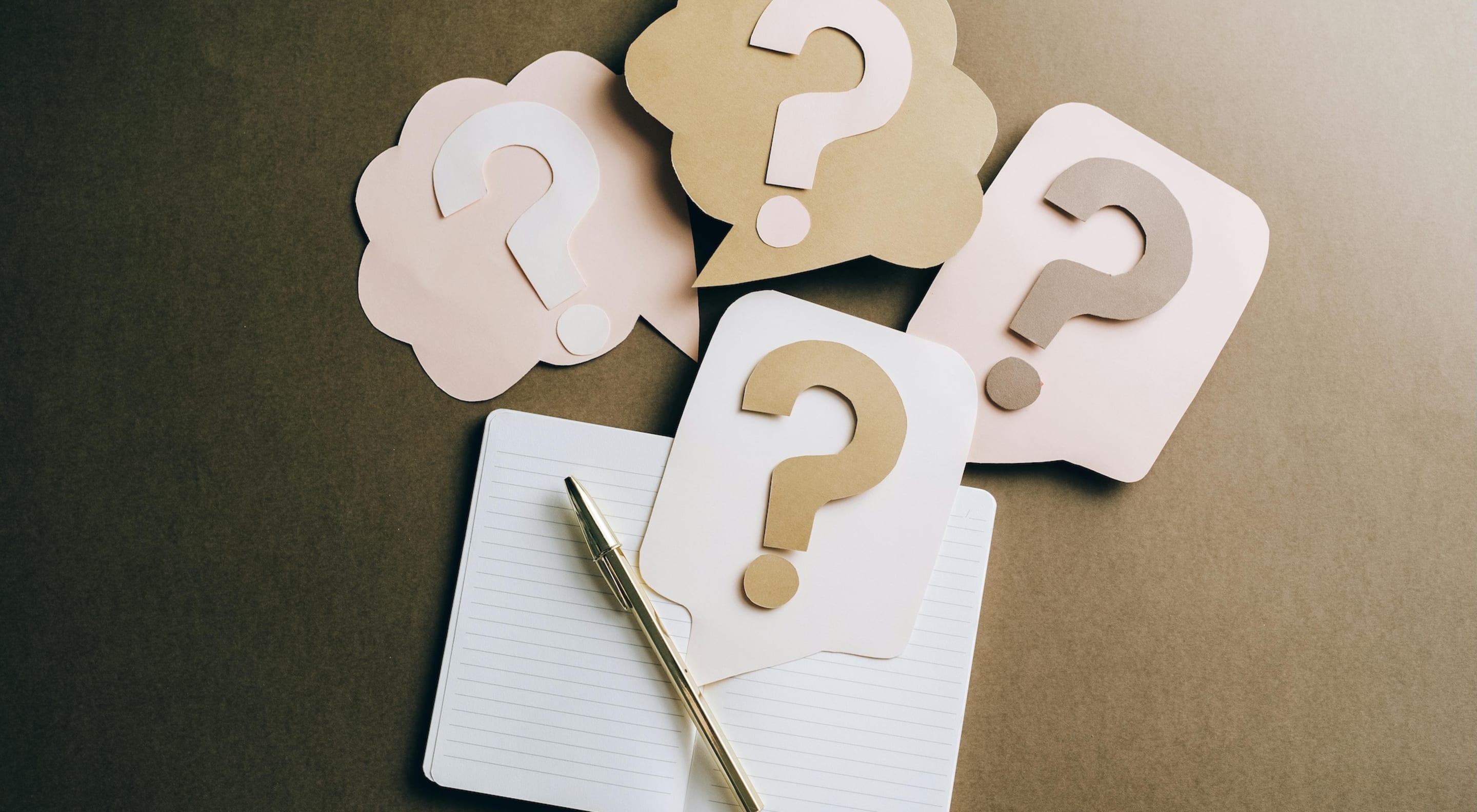
FAQ
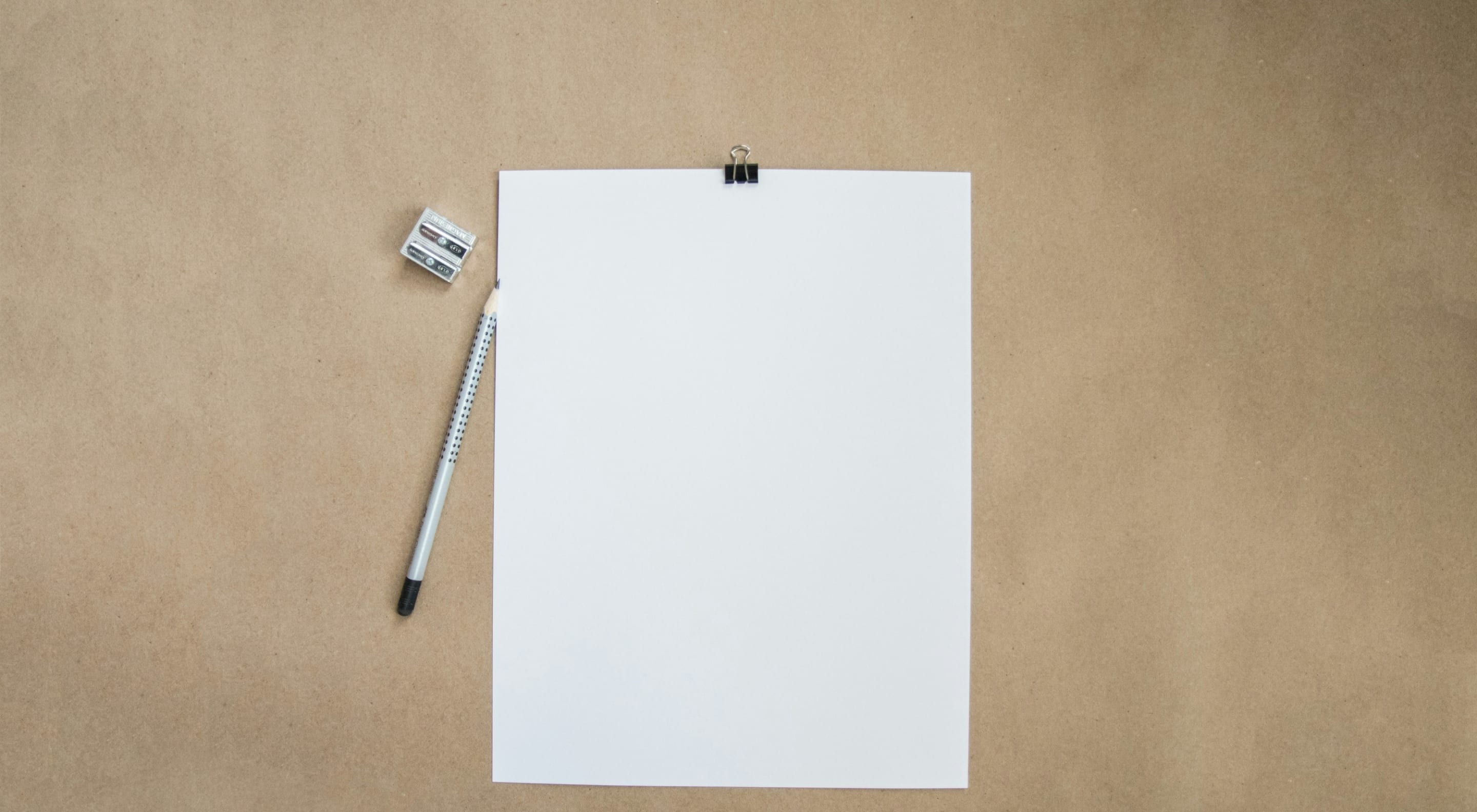
Fazit & Ausblick
Das chronische Erschöpfungssyndrom bleibt eine komplexe, herausfordernde Erkrankung, die Betroffene sowohl körperlich als auch psychisch stark einschränkt. Eine frühzeitige Diagnose, individuell angepasste Therapieansätze und gezielte Selbsthilfemaßnahmen können jedoch helfen, Symptome zu lindern und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Durch eine Kombination aus Physiotherapie, Bewegung, Ernährungsstrategien, psychologischer Unterstützung und achtsamem Selbstmanagement lässt sich der Alltag besser gestalten und Überlastung vermeiden. Aktuelle Forschung, die Einbindung von Rehabilitationsmaßnahmen sowie der Austausch in Selbsthilfegruppen schaffen neue Perspektiven für Betroffene und eröffnen Chancen, langfristig stabiler und beschwerdefreier zu leben.
Quellen & weiterführende Links für Betroffene
Weiterführende Links
- Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V.
Gemeinnütziger Verein, der sich für die Anerkennung von ME/CFS als schwere Erkrankung einsetzt. Sie bieten umfassende Informationen, politische Vertretung und eine Plattform für Betroffene.
- Fatigatio e.V.
Bietet Unterstützung, Aufklärung und setzt sich für die Verbesserung der Versorgung von ME/CFS-Betroffenen ein.
- ME/CFS Freiburg
Bietet bundesweite telefonische Beratung und Online-Meetings für Erwachsene sowie Elterntreffs für Eltern erkrankter Kinder und Jugendlicher an. Kontakt: Susanne Ritter, Tel. 07333-950196 (Mo-Fr ab 13 Uhr), E-Mail: me-cfs.beratung.susanne-ritter@web.de.
- Gesundheitsinformation.de
Stellt Informationen zur Verfügung, wie Menschen mit ME/CFS Unterstützung im Alltag erhalten können, einschließlich Hilfsmittel, Pflege oder Anpassungen der Arbeitssituation.
- ME/CFS Research Foundation
Setzt sich für mehr biomedizinische Forschung zu ME/CFS ein und fordert mehr öffentliche Forschungsförderung.
- Lost Voices Stiftung
Bietet Aufklärung über ME/CFS und betont die Bedeutung einer frühzeitigen Intervention, um Symptome zu lindern.
- EGFM (Europäische Gesellschaft für Funktionelle Medizin)
Bildet Ärzt:innen und Therapeut:innen in ganzheitlicher, ursachenorientierter Medizin aus, um chronische Erkrankungen besser zu verstehen und zu behandeln.
Deutsche Gesellschaft für Naturstoffmedizin, funktionelle Medizin und Epigenetik (DGName) e.V.
Unterstützt Forschung, Weiterbildung und Anwendung von naturstoffbasierter und funktioneller Medizin sowie epigenetischen Gesundheitskonzepten, um individuelle Prävention und Therapieansätze wissenschaftlich fundiert zu fördern.
Quellen
- ME/CFS Research Foundation & Risklayer. (2025, 12. Mai). Societal cost of Long COVID and ME/CFS in Germany severely underestimated – €63 billion in 2024 alone [Pressemitteilung]. Abgerufen von ME/CFS Research Foundation. https://mecfs-research.org/en/press/press-releases/pm-costreport-long-covid-and-mecfs/
- van der Burg, M., Mahlaoui, N., Gaspar, H. B., & Pai, S.-Y. (2019). Universal newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID). Frontiers in Pediatrics, 7, Article 373. https://doi.org/10.3389/fped.2019.00373
- Legler, F., Meyer-Arndt, L., Mödl, L., Kedor, C., Freitag, H., Stein, E., Hoppmann, U., Rust, R., Wittke, K., Siebert, N., Behrens, J., Thiel, A., Konietschke, F., Paul, F., Scheibenbogen, C., & Bellmann-Strobl, J. (2023, August 19). Long-term symptom severity and clinical biomarkers in post-COVID-19/chronic fatigue syndrome: Results from a prospective observational cohort. eClinicalMedicine, 63, Article 102146. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102146
- Bianchi, F., Textor, J., & van den Bogaart, G. (2017). Transmembrane Helices Are an Overlooked Source of Major Histocompatibility Complex Class I Epitopes. Frontiers in Immunology, 8, Article 1118. https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.01118
- Huang, Y.-W., & Hung, C.-H. (2009, Dezember). The effect of health education through the internet on university female students’ hepatitis B knowledge and cognition. Journal of Clinical Nursing, 18(23), 3342–3348. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.02907.x
- van der Burg, M., Mahlaoui, N., Gaspar, H. B., & Pai, S.-Y. (2019, 18. September). Universal newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID). Frontiers in Pediatrics, 7, Article 373. https://doi.org/10.3389/fped.2019.00373
- Schlagloth, R., & Puchta, H. (2011). Homologs of breast cancer genes in plants. Frontiers in Plant Science, 2, Article 19. https://doi.org/10.3389/fpls.2011.00019